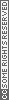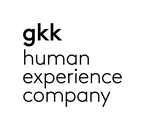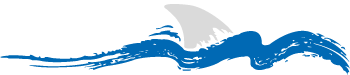Marktplätze: Was Rakuten weiter das Geschäft erschwert
11.07.2014
- Rakuten steckt in einem Teufelskreis: Ein Online-Marktplatz braucht viel Angebot, um für Kunden interessant zu werden. Für Händler wiederum ist ein Portal dann interessant, wenn sie dort viele (potenzielle) Kunden erreichen. Ein Marktplatz-Betreiber muss also an zwei Fronten kämpfen und sowohl Händler als auch Verbraucher für sein Angebot begeistern. Über Rakuten.de verkaufen aber nach wie vor erst rund 7.000 Händler , während beispielsweise eBay in Deutschland auf 175.000 gewerbliche Verkäufer kommt. Wenig Händler bedeuten wenig Angebot und damit unattraktive Preise für Verbraucher, wenn unter den Anbietern auf einer Plattform zu wenig Konkurrenz herrscht und Händler damit wenig Preisdruck ausgesetzt sind. In der Folge wird es naturgemäß schwer, Kunden zu begeistern. Und wenn diese ausbleiben, kommen auch keine Händler. Um so einem Teufelskreis zu entkommen, hat die Otto-Gruppe das Marktplatz-Modell von Quelle begraben und aus dem Portal einen Online-Shop mit eigenem Sortiment gemacht (nach eigenen Angaben auch mit Erfolg ).
- Rakuten fehlen Alleinstellungsmerkmale (für Kunden): Wenn Dickschiffe wie Amazon und eBay den Markt dominieren, hat es jeder Nachzügler schwer - vor allem mit einem autauschbaren Me-Too-Angebot. Ein Kardinalproblem von Rakuten ist aus meiner Perspektive, dass dem Online-Marktplatz ein entscheidendes Alleinstellungsmerkmal fehlt. Nun kann man dagegen halten, dass sich Händler über eigene Shop-Designs bei Rakuten prinzipiell individueller präsentieren können als etwa bei Amazon. Für den Kunden dürften in letzter Konsequenz aber Produkt und Preis entscheidend sein. Doch Artikel wie diese Digitalkamera von Canon gibt es eben auch bei Amazon . Wichtig wird dadurch wieder der Preis, wo ein Anbieter wie Amazon prinzipiell im Vorteil ist. Schließlich herrscht hier große Konkurrenz unter den Händlern, so dass diese schnell einen Preiskampf führen müssen - der zu Gunsten des Kunden ausgefochten wird.
- Rakuten verfolgt den falschen Fokus: Von anderen Playern will sich Rakuten nicht zuletzt dadurch unterscheiden, dass man Handelspartner in den Mittelpunkt der eigenen Aktivitäten rückt und beim Online-Verkauf maßgeblich unterstützt (Motto: "Empowerment"). So will sich Rakuten von Anbietern wie Amazon differenzieren, die selbst auf ihren Online-Marktplätzen verkaufen und damit in Konkurrenz zu ihren Handelspartnern treten. Aus Händlersicht ist dieser Ansatz sicher nachvollziehbar und schlüssig. Der Kunde hat meiner Meinung nach aber wenig davon, dass Rakuten seine Handelspartner stärkt. Denn mehr Angebot durch ein eigenes Sortiment bedeutet letztlich wieder mehr Konkurrenz auf einem Portal und damit wieder bessere Preise für die Endkunden. Konkurrent Hitmeister verkauft auf seinem Marktplatz jedenfalls selbst und ist damit nach eigenen Angaben auch erfolgreich .
Basis
Die kostenfreie Mitgliedschaft auf neuhandeln.de

- Kostenfrei
- Wöchentlicher Newsletter
- Zugriff auf Beiträge exklusiv nur für Mitglieder
- Teilnahme an Webinaren und virtuellen Kongressen
- Kostenloser Eintrag im Dienstleister-Verzeichnis
- Vier Wochen lang zum Test die Print-Ausgabe des Versandhausberaters frei Haus
Premium
Versandhausberater, der Premium-Dienst von neuhandeln.de:

- Sofort Zugriff auf alle Premium-Inhalte online
- Wöchentlich neue Exklusiv-Studien und Analysen
- Zugriff auf das gesamte EMagazin-Archiv
- Freitags die aktuelle Versandhausberater-Ausgabe als E-Magazin und gedruckt per Post
- 194,61 Euro pro Quartal (zzgl. MwSt)
97,31 Euro (zzgl. MwSt)*
Top-Deal!
PremiumPlus
Das Marketingpaket macht Ihr Unternehmen für über 15.000 E-Retailer sichtbar.
- Alle Leistungen der Premium-Mitgliedschaft
- Umfassender Eintrag als Dienstleister im Dienstleister-Verzeichnis
- Bevorzugte Platzierung in Suchergebnissen
- Alle Platzierungen hervorgehoben mit Firmenlogo
- Unternehmens-Einblendung unterhalb thematisch relevanter Beiträge
- Whitepaper veröffentlichen
- Pressemitteilungen veröffentlichen
- Gastbeiträge veröffentlichen
- Referenzkunden pflegen
- 995 Euro pro Jahr (zzgl. MwSt)
497,50 Euro (zzgl. MwSt)*
*Der rabattierte Preis gilt für die erste Bezugsperiode. Danach setzt sich die Mitgliedschaft zum regulären Preis fort, wenn sie nicht vor Ablauf gekündigt wird. Premium: 3 Monate/194,61 Euro, PremiumPlus: Jahr/995,00 Euro, Enterprise: Jahr/1998 Euro, jeweils zzgl. Mwst.